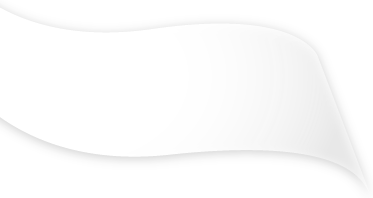Bewegte Zeiten in der AV – Ortsgruppe Mehrstetten
In den ersten Jahren nach dem Wiederbeginn 1947 tat sich die Ortsgruppe zunächst schwer, einen Weg zu finden, der sowohl den alten und tradierten Zielen der Albvereinler als auch den neuen Ideen vor allem der Jungen und der Jugendlichen gerecht wurde. Eine gewisse Unruhe im Verein lässt sich auch an den häufigen Wechseln in der Vereinsführung ablesen. So wie das ganze Volk nach den Schrecken und Traumata des Krieges sich neu orientieren musste, so geschah das auch im Kleinen, im Verein. Dass man sich da nicht immer einig war, war nur zu verständlich.
1949 wurde bei der Hauptversammlung Gerhard Schaude zum Vertrauensmann gewählt, Stellvertreter wurde Hans Kölle sen. .Bei einer Ausschusssitzung wurde die Gründung einer Jugendgruppe beschlossen, und bei einer schriftlichen Nachwahl wurden die Vertrauensmannstellen getauscht; Hans Kölle war jetzt Vertrauensmann und Gerhard Schaude sein Stellvertreter. Kurz darauf wurde der Jungalbverein Mehrstetten gegründet. Sein Vorsitzender wurde nun Gerhard Schaude. Das Konstrukt der Vereinsführung sah nun einen Ortsgruppenausschuss mit Teilen der alten Vereinsführung und dem neuen Ausschuss des Jung AV vor, wobei beide Gruppierungen jeweils für ihre Bereiche selbständige Beschlüsse fassen konnten. Die unterschiedlichen Auffassungen führten letzten Endes dazu, dass der Jungalbverein zusammen mit der Skiabteilung sich eine eigene Satzung gaben, Schriftführer Karl Ziegler wurde durch Hans Kölle jun. abgelöst. Verbindungsmann zwischen Jung AV mit Skiabteillung und der Ortsgruppe blieb Karl Ziegler.
Mittlerweile hatte sich auch der Hauptverein (sprich die Führung des Gesamtvereins in Stuttgart) eingeschaltet. Die Sondersatzung des Jung AV musste geändert werden, der Skiwart wurde zugunsten eines Wanderwartes gestrichen.
Allerdings hatte der Jungalbverein Bewegung in das Vereinsleben gebracht. Regel- mäßige Singabende in den Mehrstetter Gaststätten immer an den Samstagabenden erfreuten sich großer Beliebtheit, und mit ihren Gesangsbeiträgen gefielen die Jungen oft bei Vereinsabenden und Familienabenden.
Ein großer Erfolg für die Skiabteilung waren auch die Bezirksmeisterschaften im Skilanglauf, bei denen vor allem Georg Reutter und Karl Ziegler durch ihre Siege dem Skisport Auftrieb gaben.
Das Jahr 1952 brachte dann mit der Gründung des Wintersportvereins Mehrstetten (WSV) eine voraussehbare Trennung zwischen Albverein und den Wintersportlern, die allerdings in überaus freundschaftlicher und kameradschaftlicher Weise vor sich ging. So kann man den Protokollen des Albvereins entnehmen, dass der neu gegründete WSV für jedes Albvereinsmitglied in seinen Reihen aus der Kasse des Albvereins 1 DM bekommen solle (Beschluss vom 11.März 1952). Wie lange das beibehalten wurde, ließ sich nicht ausfindig machen. Aber man lud sich immer gegenseitig zu den Versammlungen und Vereinsabenden ein – und man half sich! Als am 19.12.1952 bei der Generalversammlung im Hirsch Vorschläge für den Wanderplan im neuen Jahr aufgerufen wurden, kam von den WSV-Mitgliedern der Vorschlag, anstatt einer Wanderung am 1. Mai beim Bau der neuen Albschanze im Böttental zu helfen. Neuer Vertrauensmann der Ortsgruppe war übrigens seit 1951 Hauptlehrer Ernst Ostertag, und unter seiner Leitung stimmte die Versammlung diesem Vorschlag begeistert zu. Beigetragen dazu hatte sicherlich auch die Zusage der örtlichen Gastwirte und des Küfers, die Arbeiterinnen und Arbeiter mit reichlich Getränken zu versorgen, worauf sich andere Geschäftsleute nicht lumpen ließen. Sie versprachen Zigaretten, Bonbons und Schokoladen, die Bäckermeisterin Brot und Brezeln und der Metzger die notwendigen Wurstwaren. Und Karl Katzmaier wollte die Arbeitenden mit dem Traktor und seinem Wagen abholen. Kurz gesagt: Bei herrlichem Maiwetter wurde der Arbeitseinsatz ein voller Erfolg und vor allem die zugesagte Verpflegung und vor allem der Genuss derselben ein High- light für alle Dabeigewesenen. Der Schriftführer Christian Mak schildert das hingebungsvoll und gerät besonders bei der Beschreibung des Genusses von Friseur Zieglers „Rathaus – Riesling“ ins Schwärmen. Gemeinsames Arbeiten, gemeinsames Singen, gemeinsames Beisammensein war für viele etwas Erstrebenswertes. Vor allem auch dann, wenn in den eigenen Reihen Liederkomponisten und –dichter dabei waren wie vor allem Karl Ziegler und auch dessen Bruder Willi Ziegler, den aber mehr aus der Ferne die Sehnsucht nach der Alb umtrieb. Lieder wie das „WSV – Lied“, das beim Wintersportverein noch heute bei vielen Anlässen gesungen wird, oder das Skifahrer Zunftlied „Die Mehrstetter haben eine saubere Zunft“, aber auch die Bergsteigerlieder „Auf hoher Warte wir uns finden, Bergsteiger von der Schwabenalb“, das „Bärental – Lied“, aber auch das heimatverbundene „d´Alb, dui liab i“ stammen aus ihrer Feder und sind es wert, gepflegt zu werden.
Alblied von Willi Ziegler (aus den 50er Jahren)
Wie groß besonders auch die Liebe und die Sehnsucht dieser ersten Bergsteigergeneration in Mehrstetten war, mag auch die folgende Anekdote erklären:
Eines Tages packte einige der Mehrstetter Bergfexe die Sehnsucht nach den Bergen, und so fasste man den Plan, einige Tage daran zu rücken und nach Oberstdorf aufzubrechen. Aber mit der Bahn zu fahren, war wohl nicht sportlich genug und kostete überdies auch Geld. Motorisiert war man nicht, also blieb das Fahrrad.
Gesagt, getan – man brach mit den Rädern auf. Räder, Fahrradmäntel und ebenso Schläuche waren ein rares Gut, die Straßen schlecht, dafür wenig Verkehr. Rucksack und Zelt wurde aufgeladen, und so ging es los – natürlich ohne Gangschaltung, die es nicht gab.
Nun muss man wissen, dass Fahrräder auch damals ein sehr beliebtes Diebesgut war , und diebische Zeitgenossen so kurz nach dem Krieg gab es überall. Da war – in Oberstdorf angekommen – guter Rat teuer: Wohin mit den Rädern? Man wollte und musste unbedingt auf das Nebelhorn und einmal mit der damals gerade 20 Jahre alten Kabinenbahn fahren. Blieb nur eines: Die Räder mussten mit.
So fuhr man mit den Rädern bis zur Bergstation. Aber von hier bis zum Gipfel gab es keinen Radtransport!
Heute wäre es nichts Besonderes, fahrradschleppende Sportler im Gebirge zu sehen. Allerdings mit superleichten Karbonrahmen und nicht mit gewichtigen Velos, dazu bepackt mit Rucksäcken und Zeltbahnen.
Aber es half nichts: die Räder samt Gepäck mussten mit hinauf zur Gipfelhütte. Lieber schwitzen als nachher ohne Rad dastehen, war die Devise.
So waren die Mehrstetter Gebirgskraxler wohl einige der ersten, die das Nebelhorn mit dem Fahrrad bezwangen.
Fortsetzung folgt