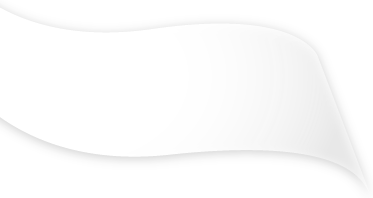Überhaupt die Fortbewegungsmittel spielten bei den Unternehmungen der Albvereinler eine immer größere Rolle – einmal abgesehen von den Skiern im Winter. Die waren zwar immer aktuell, aber sportlich gesehen übernahm hier natürlich der Wintersportverein (WSV) immer mehr die Regie, natürlich gar nicht verwunderlich, dass hier ein ehemaliger Vertrauensmann und Jugendwart, nämlich Gerhard Schaude, das Kommando übernahm. Aber zu den Fortbewegungsmitteln: In den Anfangsjahren (ab 1920) staunt man immer mehr über die doch gewaltigen Entfernungen, die – unterstützt von der Eisenbahn – zu Fuß zurückgelegt wurden, bei Fußwanderzeiten von nicht selten mehr als 8 und 9 Stunden! Dann taucht aber immer wieder, so Ende der 20er Jahre bis in die 30er Jahre das Fahrrad auf. Auch das war manches Mal eine Herausforderung. Zunächst für die Lenker der Räder selbst, die dem mitgeführten oder unterwegs „zufällig gefundenen“ Most zu sehr zugesprochen hatten, und in der Folge für Schneidermeister Eugen Breitinger, der Hosen und Jacken nach diversen Stürzen (an denen aber immer die schlechten Wegeverhältnisse schuld waren) wieder in einen brauchbaren Zustand zurechtflicken und –bügeln musste. Nach dem Krieg zeigt sich auch bei Wanderungen die zunehmende Motorisierung. Bei kleineren Unternehmungen war das oft das Motorrad, für größere Gruppen wird es zunehmend der Omnibus, der Männlein und Weiblein entweder in das Zielgebiet oder aber auch nur spät am Abend wieder nach Hause brachte. Aber nicht nur die Fortbewegungsmittel änderten sich mit der Zeit. Unruhig blieb es auch in der Vereinsführung. Natürlich waren diese Nachkriegsjahre für alle eine sehr bewegte Zeit. Berufliche und persönliche Neuorientierungen spielten ebenso eine wichtige Rolle wie auch weltanschauliche Positionierungen. Für viele waren Worte wie „Heimat“, „Volksgut“, „Brauchtum“ und andere mehr durch ihren Missbrauch im vergangenen 3.Reich mit falschen Vorstellungen besetzt. Man konnte sich nicht mehr so gut damit identifizieren. Auch Lieder und Liedtexte, oft jahrhundertealt, kamen dadurch in Verruf. Und mittendrin der Albverein, der genau in diesen Beschreibungen sein Hauptaufgabengebiet schon immer gesehen hatte. So führte ab 1949 Küfermeister Hans Kölle den Verein, gab diesen aber schon 1951 an Hauptlehrer Ernst Ostertag ab. Er blieb Vertrauensmann bis 1956, und wurde dann von dem Bundesbahner Hermann Haible abgelöst. Schon nach 2 Jahren wurde wieder ein neuer Vertrauensmann gesucht, weil Hermann Haible aus beruflichen Gründen das Amt aufgeben musste. Diesmal blieb das Amt in Bundesbahnerhänden. Mit Hermann Schmauder kehrte nun für viele Jahre Ruhe in den Vorstandsreihen der Ortsgruppe Mehrstetten ein, was der gesamten Entwicklung sehr gut tat. Bis 1977 sollte er nun fast 20 Jahre an der Spitze des Mehrstetter Albvereins stehen, und daran werden sich viele der heutigen Mehrstetter, und nicht nur der Albvereinler, noch sehr gut erinnern können. Nicht nur die Personen in der Vereinsführung wechselten. Auch die Jahresprogramme bekamen mit der Zeit ein anderes Gesicht. Natürlich blieb auch weiterhin das Wandern eine der Hauptaufgaben der Ortsgruppe, vor allem aber die Geselligkeit, die Angebote für Nichtmitglieder zur Teilnahme an Veranstaltungen, die mehr und mehr von Leuten aus den eigenen Reihen gestaltet wurden, erfreuten sich großer Beliebtheit. Zu nennen wären da die hervorragenden Lichtbildvorträge (mit eigenem Bildmaterial) von Willi Ziegler, die heimatkundlichen Vorträge von Dr. Christian Eberhardt, aber auch die vom Hauptverein angebotenen literarischen und naturkundlichen Vorträge, die alle großen Zulauf hatten. Aber auch einige Beiträge in den Protokollbüchern, die man getrost unter „Kurioses“ oder unter „Besonders Erwähnenswert“ aus dieser Zeit anführen darf, sollen nicht unerwähnt bleiben. Beispiel gefällig? Ein Antrag aus der Mitte des Ausschusses betraf den kläglichen Gesang zu Beginn der öffentlichen Versammlungen des Albvereins. So sollte in Zukunft nur noch in den Albverein aufgenommen werden, wer das Albvereinslied in allen Versen vorsingen bzw. aufsagen konnte („So steckt dies Zeichen an den Hut…“). Die Frühwanderung am 1. Mai begann immer am Lindele auf dem Marktplatz. Der Start verzögerte sich aber des Öfteren um einige Zeit, weil die Wandergruppe „zuerst eine ausführliche Besichtigung der dort ordentlich aufgestellten Ausstellung landwirtschaftlicher Geräte vornehmen musste, die so groß war, dass man sich die Fahrt zu einer solchen Ausstellung sparen konnte.“ Einmal war sogar zur Bewachung eine Hundehütte mit Hund dazu gestellt worden. (Anmerkung: dies wiederholte sich viele Jahre später noch einmal, nur dass der Hund mit Hütte auf dem Dach des damaligen Kreissparkassenpavillons ein ebenfalls dort geparktes Kleinauto bewachte!).
Der 1. Mai hatte es in sich! So gab es 1956 zu der Wanderung viel Schnee und Kälte wie im November. Und dann war da noch die Hauptversammlung des Vereins in Ravensburg. Ein Mitglied der Mehrstetter Abordnung kam doch tatsächlich einen Tag zu spät dort an und erst 1 Woche später wieder nach Hause. Näheres ist den Büchern nicht zu entnehmen.
Auch die Frage nach den Beiträgen, die vom Albverein an den WSV abgeführt werden sollten (für die Mitglieder der Skiabteilung, die auch dem WSV beigetreten waren), findet 1956 eine Antwort: Da die Kassenlage bei beiden Vereinen bedauerlicherweise „kläglich“ ist, wird dies im beiderseitigen Einvernehmen eingestellt. Aber der Vorsitzende des WSV (Walter Heimberger) ist auch Mitglied im Ausschuss der Albvereins – Ortsgruppe. Mit Hermann Schmauder als Vertrauensmann und Motor nahm die Vereinsarbeit immer mehr an Fahrt auf. Viele Dinge, die mittlerweile selbstverständlich Teil der Vereinsarbeit waren und noch sind, nahmen ihren Anfang. Waldweihnachtsfeiern, Familienabende mit Theateraufführungen, mehrtägige Wanderfahrten, die jährliche mehrtägige Hochgebirgswanderung und vieles mehr begann die Ortsgruppe zu prägen. Nicht zu vergessen die Selbstverständlichkeiten wie die Pflege des Wanderwegenetzes und der Naturschutz. Dazu kam ab 1960 der Beginn der Dorfsanierung. Mehrstetten als Musterdorf und Beginn der Flurbereinigung Ortslage, was einen nie dagewesenen Umbruch im Ortsbild und natürlich auch in der Umgebung mit sich brachte, eine Herausforderung für alle, die sich bis zum Abschluss der Maßnahmen insgesamt – Flurbereinigung Feldlage, Dorfsanierung und Flurbereinigung Ortslage – über mehr als 30 Jahre (1952 -1984) erstrecken sollte und immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen der Ortsgruppe des Albvereins und der Gemeinde bzw. der ausführenden Flurbereinigungsbehörde führte. Keine einfache Zeit für viele Albvereinler, die einerseits die Interessen des Albvereins und den Schutz seiner Ziele verfolgten, die aber andererseits sei es als Mitglieder des Gemeinderates oder der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung auch hier in der Verantwortung der Dorfgemeinschaft standen.
Sicher ist: Der Begriff Naturschutz beschränkte sich lange Zeit viel zu sehr auf die Pflege und den Schutz einzelner Pflanzen und ihrer Standorte und hätte schon viel früher durch den umfassenderen Begriff Umwelt- und Landschaftsschutz ersetzt werden müssen. Ausgeräumte Feldmarken, Abholzung von landschaftsprägenden und –schützenden Feldhagen und –hecken wären vielleicht vermieden worden. Aber hätte, wäre, könnte… Ein neues Kapitel der Ortsgruppengeschichte begann Anfang der 60er-Jahre. Die Jugend begann sich zu rühren. Die Kontakte zu der Ortsgruppe in Münsingen führten zu gemeinsamen Volkstanzaufführungen bei Vereinsabenden. Paula Rittman, Handarbeitslehrerin aus Münsingen, machte das zusammen mit jungen Paaren aus Mehrstetten und Münsingen, und Reinhold Mayer sammelte einige Jugendliche um sich, um mit ihnen ganze Wochenferienwanderungen zu machen. So erwanderten sie ab 1965 zuerst den Südschwarzwald, dann den Odenwald und 1967 die Lüneburger Heide mit Abstecher nach Lübeck, Hamburg und Helgoland. Für viele Jahre blieb ab jetzt die Jugendarbeit ein herausragender Bestandteil der Vereinsarbeit, ohne die anderen Bereiche zu vernachlässigen. Fortsetzung folgt