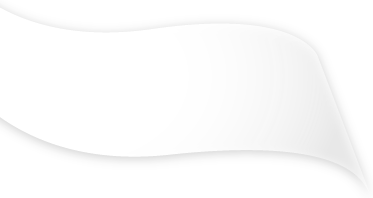Teil 2
Bei der Betrachtung dieser Gründungszeit darf man nicht vergessen: der 1. Weltkrieg mit seinen mörderischen Schlachten war gerade mal 2 bis 3 Jahre vorbei, der Versailler Vertrag hatte Deutschland mit immensen Reparationsforderungen wirtschaftlich an den Rand gebracht – und die Männer und Frauen in der neu gegründeten Ortsgruppe des Albvereins fanden Zeit und Muße, um sich um ihre Heimat zu kümmern. Oder auch gerade deswegen.
Im Protokollheft aus dieser Gründerzeit beschreibt der Schriftführer in dichterisch-schwärmenden Worten die Schönheit der Heimat. Wandern und Schauen ist das höchste Ziel.
Wandern und die Heimat kennenlernen, alles in sich aufsaugen, was sich dem Auge bot, war Herzensangelegenheit. Körperliche Strapazen nahm man gerne auf sich, alles gepaart mit einem guten Teil Abenteuerlust. So machte man sich zu zweitägigen Wanderungen auf, mit einem gut gefüllten Rucksack (wegen des Vespers), aber ohne Plan und Idee, wo man denn übernachten könnte. Oft half der Zufall und auch das Vertrauen der Menschen in die Wandergruppe. So stellte bei einer dieser Mehrtageswanderungen das „Auge des Gesetzes“, der Polizeidiener in Tiergarten im Oberen Donautal seine Scheune zur Verfügung (nebst reichlich Malzkaffee am Morgen), oder man traf beim Abstieg von der Teck nach Owen einen „Landsmann“ aus Hundersingen, der in Unterlenningen verheiratet war. Kurzent- schlossen lud er die Landsleute von der Alb zu sich nach Hause ein – immerhin eine erkleckliche Zahl -, die sich seinen „Unterländer Most aus seinem 1000 – Liter- Fass“ wohl schmecken ließen.
Natürlich nahm man, wenn es sich machen ließ, die Eisenbahn für Teilstrecken in Anspruch. Man hatte schließlich mit Schriftführer Failenschmid einen versierten Eisenbahner im Verein. Aber die Strecke bei der zweitägigen Wanderung von Mehrstetten über Gruorn, Römerstein, Schopfloch, Randecker Maar, Breitenstein, Ruine Rauber, Sattelbogen zur Teck, dann nach Owen- wo man durch puren Zufall den Landsmann aus Hundersingen traf, und am anderen Tag weiter über den Hohen-Neuffen, Grabenstetten, das Fischburgtal und Trailfingen wieder nach Mehrstetten war reine Fußarbeit.
Das war aber nicht die ganze Idee der ersten Albvereinler. Größere Projekte wurden in Angriff genommen. Der schon erwähnte Fußweg zum „Hauptbahnhof“ im Heutal war immer wieder Thema, Weg Bezeichnungen mussten angebracht werden, die Pflege und Bepflanzung der Hüle beim Hirsch (später auch der Albvereinsgarten genannt), auch die Bepflanzung der Rauen Hüle am Weg nach Bremelau und Beseitigung alter Bäume dort wurde angegangen.
Vorträge und Familienabende „mit theatralischen Aufführungen“ fanden großen Anklang. Bei einem dieser Vorträge 1922 war auf Vermittlung von Oberlehrer Freitag aus Ennabeuren der schwäbische Heimatdichter August Lämmle nach Mehrstetten gekommen.
Die Frage bleibt – und hier geben die Protokollbücher nur wenig Auskunft: Wie war das alles in dieser wirtschaftlich prekären Zeit – immerhin steckte man in der schwersten Inflation – zu stemmen?
Anfang 1922 wurde wegen der schlechten Kassenlage eine Haussammlung durch- geführt, die 822 Mark erbrachte. Eine Saalsammlung bei einer Veranstaltung erbrachte 122 Mark. Im November 1922 wurde der Ortsgruppenbeitrag (dieser wird zusätzlich zum Beitrag für den Hauptverein erhoben) auf 5 Mark (!!!) festgesetzt.
Auch wurde eine Reisekasse beschlossen, da für viele die Teilnahme an Wanderungen (z.B. mit Zugfahrten) finanziell nicht mehr möglich war.
Und plötzlich, ab Mai 1923, ist von dem so umtriebigen Albverein in Mehrstetten nichts mehr zu hören. Aber im Frühjahr 1924 meldet der Schriftführer:
„Wer glaubte, der Albverein sei tot, hat sich gründlich geirrt! Das letzte Dreivierteljahr war eine sogenannte Schlummerzeit, um jetzt zu neu gestärktem Leben zu erwachen!“
Fortsetzung folgt